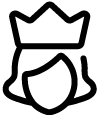In einer Welt, die immer lauter nach Individualität schreit, scheint es, als sei das Label einer psychischen Erkrankung oder Persönlichkeitsstörung zum Accessoire geworden – Neurodiversität wird gefeiert wie ein neues Lifestyle-Produkt, während ernste Erkrankungen wie Depressionen, ADHS oder Borderline in sozialen Medien mit einem beinahe romantischen Schleier überzogen werden. Ist das wirklich der Weg zu mehr Akzeptanz – oder bewegen wir uns in eine gefährliche Richtung, die Leiden trivialisiert?
Die Modeerscheinung des Andersseins
Es gibt einen Unterschied zwischen dem notwendigen Abbau von Stigmata und der Glorifizierung von Diagnosen. Während früher Menschen oft aus Angst vor Diskriminierung schwiegen, scheint es heute fast schick zu sein, mit einer psychischen Erkrankung zu kokettieren. Auf TikTok und Instagram posten Influencer charmant über ihre „quirky“ Neurosen, versehen mit ästhetischen Bildern und motivierenden Hashtags wie #MentalHealthAwareness. Die Message: „Ich bin anders, und das macht mich besonders.“ Aber was passiert, wenn das Anderssein zur Norm wird und wir uns in einer Wettbewerbskultur wiederfinden, in der die „exklusivste“ Diagnose als Statussymbol gilt?
Die Romantisierung des Leidens
Es gibt nichts Schönes daran, wenn jemand von einer Depression gelähmt im Bett liegt oder durch die Symptome einer Angststörung vom sozialen Leben abgeschnitten ist. Doch auf Social Media sehen wir oft das Gegenteil: Weichgezeichnete Bilder von Tränen auf dem Kissen, begleitet von poetischen Texten, die Leid in Kunst verwandeln. Natürlich kann Kunst aus Schmerz entstehen – aber müssen wir das Leid dazu erst in Watte packen, um es konsumierbar zu machen?
Indem wir psychische Erkrankungen auf diese Weise darstellen, entziehen wir ihnen oft ihre wahre Schwere. Schlimmer noch: Wir ermutigen Menschen, die keine professionelle Diagnose haben, sich selbst in Kategorien zu pressen, die vielleicht gar nicht auf sie zutreffen. Plötzlich ist jeder introvertierte Tag ein „Burnout“, jede Laune eine „bipolare Episode“.
Die Selbstdiagnose entschuldigt charakterlichen Defizifite:
Du hast Dich nicht im Griff? ADHS.
Du bist von allen genervt? Hochsensibel.
Du verhältst Dich wie der letzte Arsch? Das muss Authismus sein, auf keinen Fall miese Sozialisation.
Die Folge? Eine Banalisierung, die denen schadet, die wirklich unter diesen Krankheiten leiden.
Neurodiversität: Vom Spektrum zum Statement
Der Begriff Neurodiversität wurde geschaffen, um Vielfalt im Denken und Wahrnehmen zu feiern – und das ist auch gut so. Menschen mit Autismus, ADHS oder anderen neurologischen Besonderheiten sollten weder diskriminiert noch übersehen werden. Doch auch hier beobachten wir eine problematische Entwicklung: Neurodiversität wird zunehmend als Identität überhöht, die jegliche Kritik an Verhaltensweisen oder Schwierigkeiten im Alltag abschirmt. „Ich bin halt so“ wird zum Freibrief für alles, von chronischer Unpünktlichkeit bis zu fehlender Empathie.
Während die Absicht dahinter oft gut gemeint ist, gerät die eigentliche Diskussion – wie wir Menschen mit echten Herausforderungen unterstützen können – in den Hintergrund. Neurodiversität wird zu einer Marke, einer Identität, die manche Menschen bewusst suchen, um sich von der Masse abzuheben.
Die Gefahr der Selbstdarstellung
Wir leben in einer Zeit, in der Selbstdarstellung alles ist. Krankheiten und Störungen werden zum Content, und Content ist Währung. Doch welche Botschaft senden wir, wenn wir Leid monetarisieren? Psychische Gesundheit wird zur Ware, und der Fokus verschiebt sich von Heilung zu Aufmerksamkeit.
Diese Entwicklung hat auch reale Konsequenzen: Wartelisten für Psychotherapie werden immer länger, nicht zuletzt, weil viele Menschen, die keine Behandlung brauchen, den Bedarf überstrapazieren. Währenddessen bleiben diejenigen, die wirklich Hilfe benötigen, oft auf der Strecke.
Verantwortung statt Romantisierung
Es ist wichtig, über psychische Erkrankungen und Neurodiversität zu sprechen. Aber das Narrativ muss ehrlich bleiben. Leid ist nicht romantisch und Anderssein nicht automatisch eine Marke. Anstatt psychische Diagnosen zu überhöhen oder zu trivialisieren, sollten wir Raum schaffen für echte Gespräche, die auf Verständnis und Unterstützung abzielen – nicht auf Likes.